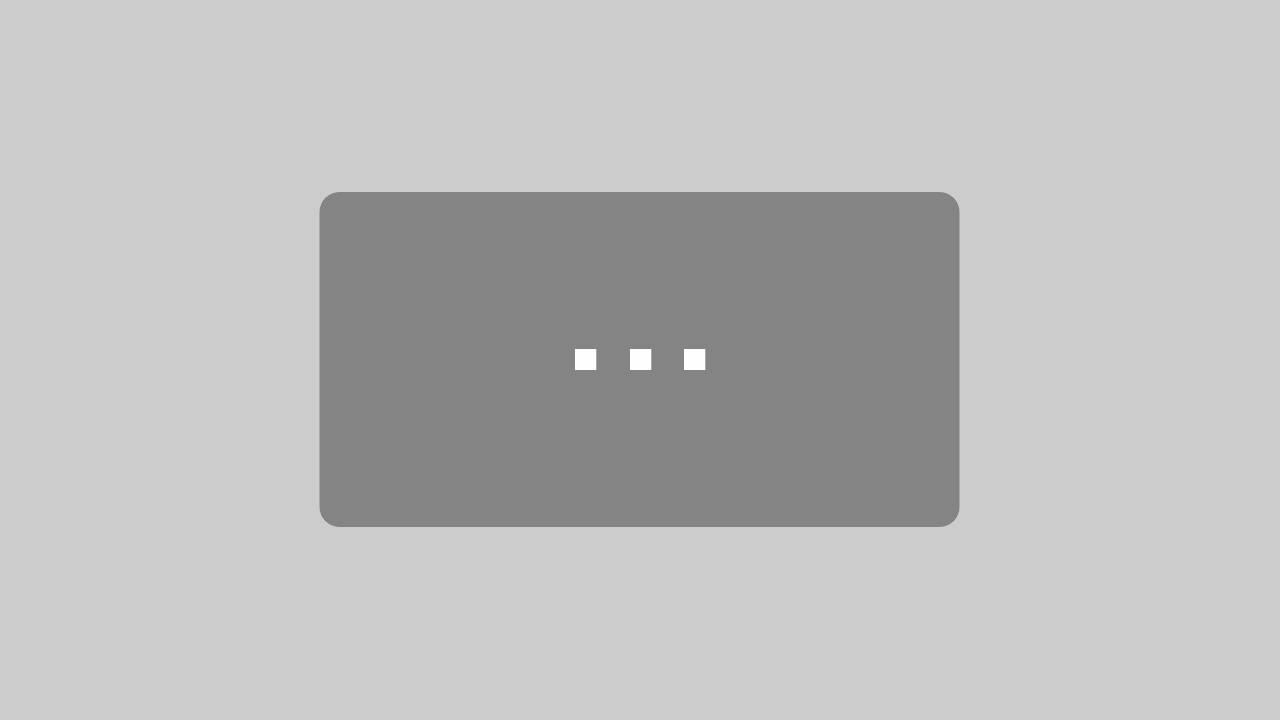„Weltwirtschaft benötigt mehr Finanzierung durch Eigenkapital, nicht durch Schulden“
Nach Ansicht des britischen Vermögensverwalters LGIM sind die großen Notenbanken auf einem Irrweg.
Die quantitativen Lockerungsmaßnahmen (QE) der großen Notenbanken sind nicht die Medizin, mit der das Wachstum der Weltwirtschaft wieder nachhaltig auf die Beine kommt, solange das strukturelle Problem des globalen Schuldenüberhangs ungelöst ist. Zu dieser Einschätzung kommt Ben Bennett, Head of Credit Strategy beim britischen Asset-Manager Legal & General Investment Management (LGIM) in seinem jüngsten Ausblick. „Sollten zukünftige Daten weiterhin ein enttäuschendes Wachstum signalisieren, wird man wahrscheinlich erneut die Notenpresse anstellen“, sagt Bennett. „Aber dieser Versuch wird genauso wenig erfolgreich verlaufen wie alle vorangegangenen.“ Allerdings gibt es dem LGIM-Experten zufolge viele Marktteilnehmer, die weiterhin hofften, dass die extrem lockere Geldpolitik der Zentralbanken irgendwann doch noch Wirkung zeige. „Für mutige Investoren kann das durchaus eine Gelegenheit sein, taktische Positionen aufzubauen und von einer zwischen-zeitlichen Rallye zu profitieren“, so Bennett. „Doch uns scheint es wichtiger, sich auf Enttäuschungen vorzubereiten, von denen wir meinen, dass sie unweigerlich kommen werden.“
Befürworter der quantitativen Lockerungsmaßnahmen argumentieren zwar, dass es fraglich ist, ob die Entwicklung in den vergangenen Jahren ohne das Eingreifen die Notenbanken so glimpflich verlaufen wäre oder dass die bisher eingeleiteten Maßnahmen zu gering sind, um die erhoffte Wirkung zu erzielen. Dies hält Bennett allerdings für nicht überzeugend. „Das Einzige, was QE erfolgreich geschafft hat, ist, dass Vermögenswerte Rückenwind haben. Schließlich muss die zusätzliche Liquidität, die in die Märkte gepumpt wird, irgendwo untergebracht werden“, so der Anleihestratege. Nach Ansicht von Bennett mit fatalen Folgen: Die Unternehmen leihen sich billig Geld, das sie dann etwa in Form von hohen Dividenden an die Aktionäre ausschütten, die es wiederum an den Aktienmärkten anlegen. „Dies erstickt jede wirtschaftliche Dynamik im Keim, weil es die Unternehmen vorziehen, Geld an ihre Anteilseigner zu geben anstatt damit für die Zukunft zu investieren. Die Weltwirtschaft benötigt mehr Finanzierung durch Eigenkapital, nicht durch mehr Schulden – und QE erreicht genau das Gegenteil davon“, so Bennett. Er gibt außerdem zu bedenken, dass durch die günstigen Finanzierungskonditionen auch an sich unrentable Geschäftsmodelle am Leben erhalten werden. Zudem profitieren von der aktuellen Geldpolitik die Vermögenden, während es für die weniger Betuchten aufgrund nur geringer Lohnzuwächse zunehmend schwieriger würde, Vermögen aufzubauen. „Das ist doch pervers. Anstatt den Konsum anzukurbeln sorgt QE dafür, dass die weniger Vermögenden mehr und mehr sparen müssen, um aufgrund der niedrigen Zinsen eine gesicherte Existenz aufbauen zu können. Die Reichen werden reicher und die Armen müssen sehen, was für sie übrig bleibt.“
Nach Einschätzung des LGIM-Experten werden die Aktien- und Anleihekurse jedoch aufgrund schwächerer Unternehmensgewinne und steigenden Ausfallrisiken irgendwann zwangsläufig nach unten korrigieren. „Im Ergebnis stehen die Investoren dadurch vor einer schwierigen Anlageentscheidung: entweder diszipliniert eine langfristige Strategie verfolgen oder auf kurzfristige Kursaufschwünge setzen“, so Bennett. „Unsere Antwort darauf ist, den Blick auf die Grundbausteine im Portfolio zu richten und Risikoanlagen solange unterzugewichten, bis der weltweite Schuldenüberhang abgebaut worden ist. Angesichts des zaghaften Zinsschritts der Fed und der weiterhin offensiven Geldpolitik der Notenbanken in Europa, Japan und China könnte es aus taktischer Sicht allerdings ein kluger Schachzug sein, auf niedrigem Niveau einzelne Unternehmensanleihen zu kaufen.“