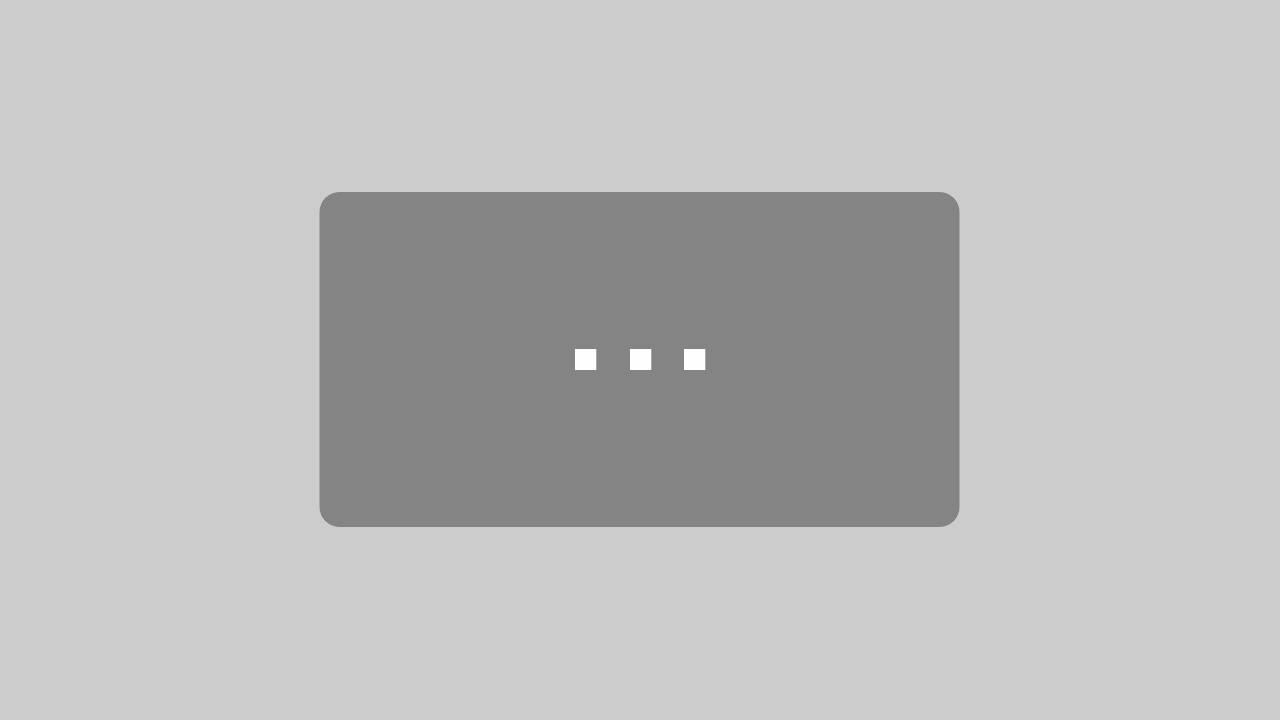Jerome Powell hat derzeit einen leichten Job. Der US-Notenbankchef kann eine ganz normale Geldpolitik betreiben. Zumindest auf den ersten Blick. Die Wirtschaft boomt. Das Ziel der Vollbeschäftigung ist erreicht. Im Mai stieg die Inflation zum Vorjahresmonat um 2,8 Prozent. Die selbst definierte Zielmarke der Federal Reserve (Fed) liegt bei 2,0 Prozent.
Die logische Folge: Die Fed zieht die Zinsen hoch. Bis Ende des Jahres avisieren die Notenbanker weitere Anhebungen. „Business as usual“, könnte man meinen.
Wer genauer hinsieht, dem kommen allerdings Zweifel. Warum beträgt etwa die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen immer noch drei Prozent? Vor sieben Jahren – und vor sieben Leitzinserhöhungen und dem Ende des Anleihekaufprogramms – betrug die Rendite noch knapp 4,5 Prozent. Die Zinswende, um es im Geldanlegerjargon auszudrücken, scheint „am langen Ende zu verpuffen“. Und unseres Erachtens dürfte das wohl auch für die nächsten Leitzinsanhebungen der Fall sein.
Dafür gibt es Gründe. Die Nullzinspolitik in der Eurozone und Japan hängen wie ein Gewicht an den US-Renditen. Schon heute locken die im Vergleich deutlich attraktiveren Renditen. Wer sich beispielsweise in Europa und den USA auf die Suche nach vermeintlich sicheren Anleiheinvestments begibt, findet bei US-Staats- und Unternehmensanleihen eine um etwa drei Prozentpunkte höhere Rendite schon in Laufzeitbereichen ab 5 Jahren.
Bei solchen Renditedifferenzen treten für viele Anleger mögliche Währungsrisiken zunehmend in den Hintergrund. In der Folge steigt die Nachfrage nach US-Anleihen, was deren Renditeentwicklung – selbst bei steigenden Leitzinsen – deckelt. Eine weiter steigende Nachfrage bei noch höheren Renditedifferenzen würde zudem den US-Dollar weiter aufwerten lassen – mit entsprechend negativen Auswirkungen nicht nur auf die Wettbewerbsfähigkeit von US-Unternehmen. Auch für viele in US-Dollar verschuldete Schwellenländer wäre der Mix aus steigenden Zinsen und einem starken Dollar eine Herausforderung. Die dadurch entstehenden Risse erreichen früher oder später wieder die US-Wirtschaft und beeinflussen dann letztlich auch die Geldpolitik der Fed.
Wir glauben nicht daran, dass die Zinsen in Europa in absehbarer Zeit deutlich steigen werden. Ob die Europäische Zentralbank (EZB) ab Sommer nächsten Jahres ihren Leitzins (ein wenig) anhebt, ist für uns noch längst nicht ausgemacht. Zu groß scheinen die Probleme der Eurozone. Die ausufernden Staatsschulden, die nur mit niedrigen Zinsen finanzierbar sind. Die unterschiedlichen Ökonomien, die vielleicht niemals im Gleichklang laufen. Unser Währungsraum bleibt fragil, auf Unterstützung der Notenbank angewiesen. „Whatever it takes“ lautet hier der Leitspruch – von „Business as usual“ kann keine Rede sein.
(Flossbach von Storch)