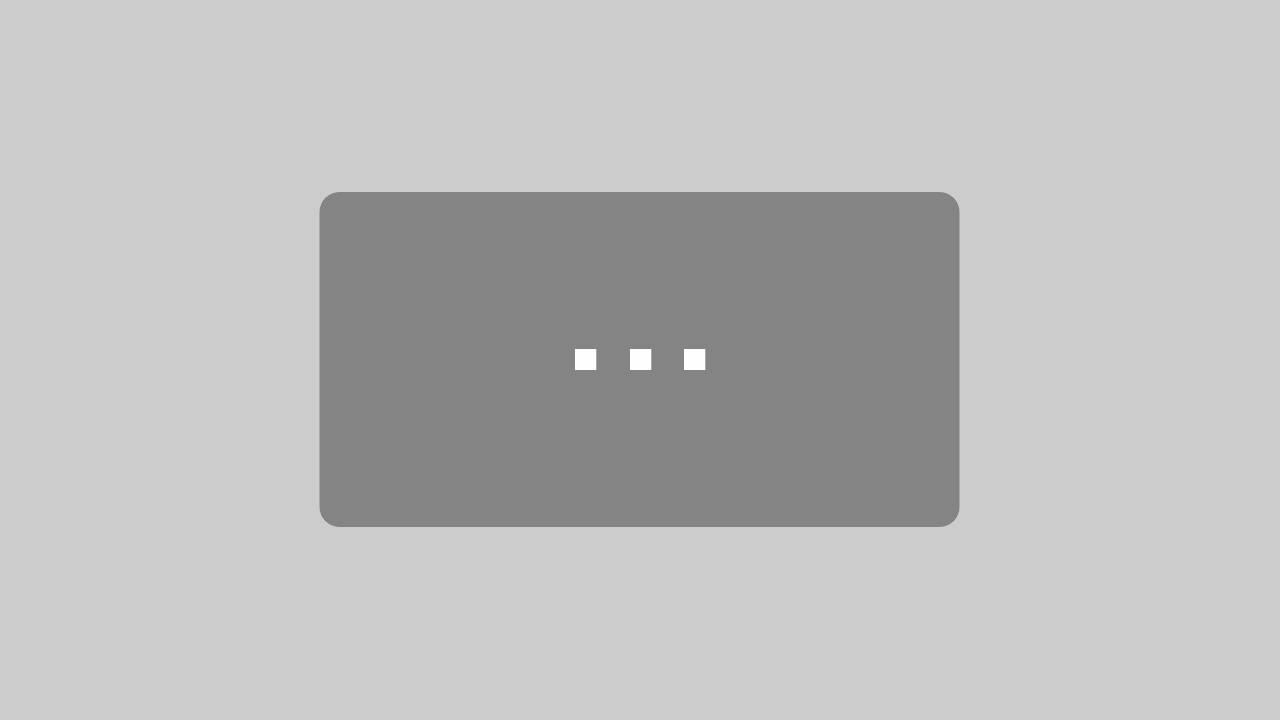Der Präsident der öffentlichen Banken kritisiert auch die Vielzahl an Datenanforderungen der EZB, die sich zudem auch noch häufig verändern. Hinzu kommt, dass die EZB in ihrer Aufsichtstätigkeit keine Rücksicht auf nationale Rechnungslegungsvorschriften nimmt. So verlangt sie beispielsweise von einzelnen Instituten, die bisher nach HGB bilanzieren, im Zusammenhang mit der aktuellen Konsultation zur Harmonisierung von Aufsichtsrechten eine Lieferung von Bilanzdaten sowie des regulatorischen Eigenkapitals nach IFRS-Regeln.
Dunkel: „Die Übermittlung von IFRS-Daten für HGB-Bilanzierer ist nicht nur sehr aufwendig und in dem vorgegebenen engen Zeitplan nicht darstellbar, sondern sie widerspricht auch den Regelungen der SSM-Verordnung.“ Von zentraler Bedeutung sieht Gunter Dunkel auch die Ausgestaltung des Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) durch die EZB, dem es aktuell entscheidend an Transparenz fehlt. Der Spitzenverband der öffentlichen Banken plädiert daher ausdrücklich für eine komplette Offenlegung der Anforderungen, die an die Institute gestellt werden, um die getroffenen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank nachvollziehen und vor allem auch in die Kapitalplanung einbeziehen zu können.
Dunkel: „Mit dem SREP nimmt die EZB maßgeblich Einfluss auf das Geschäftsmodell einer Bank. Eine einheitliche Aufsichtspraxis darf aber nicht zu dem Fehlanreiz von einheitlichen Geschäftsmodellen oder gar zu SSM-idealen Banken führen, die nicht zu Deutschland und Europa passen.“ Ebenso appelliert Dunkel, dass die laufende Initiative der EZB zur Harmonisierung der Aufsichtswahlrechte in der Kapitaladäquanzverordnung (CRR) und der Kapitaladäquanzrichtlinie (CRD) nicht dazu führen darf, dass Besonderheiten bei den Förderbanken und Landesbanken vernachlässigt werden, wie zum Beispiel die Nullgewichtung von Forderungen an Förderinstitute.
„Mit dem Start des Einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) am 1. Januar 2016 wird der zuständige Behördenkreis nochmals erweitert. Umso mehr fordern wir eine klare Aufgabenteilung zwischen der EZB, den europäischen Finanzaufsichtsbehörden, den nationalen Aufsehern sowie den Abwicklungsbehörden bei der Regelsetzung und Beaufsichtigung der Banken. Die Bank als das zu beaufsichtigende Institut steht heute inmitten der Regulierer und soll es jedem der elf Aufseher mit ihren teils unterschiedlichen Interessen Recht machen. Das macht uns große Sorgen“, so der VÖB-Präsident.
Geschäftsentwicklung der öffentlichen Banken
Die Konsolidierung der Bankbilanzen der Landesbanken der letzten Jahre ist heute weitgehend abgeschlossen. Seit 2007 wurden in der Institutsgruppe über 50 Prozent der Risikoaktiva abgebaut. Betrug die kumulierte Bilanzsumme im Jahr 2008 noch 1,8 Billionen Euro, so ist diese bis zur Jahresmitte 2015 auf 1,16 Billionen Euro zurückgegangen. Diese Reduzierung ging in der Regel einher mit einer Refokussierung auf die jeweiligen Kerngeschäftsfelder.
Auch die Ertragslage der Landesbanken hat sich weiter stabilisiert. Der Return on Equity lag Ende 2014 im Schnitt bei ca. 6,5 Prozent und die Cost-Income-Ratio – trotz der zunehmenden Regulierungskosten – bei 58,3 Prozent. Auch die Förderbanken konnten im gleichen Zeitraum ihre Ertragslage ausbauen, wenngleich die Erträge hier naturgemäß nicht in gleichem Maße im Vordergrund stehen. Die Kapitaldecke (CET 1) der Landesbanken betrug in diesem Zeitraum etwa 11,5 Prozent. Traditionell besser stehen hier die Förderbanken da, deren durchschnittliche Kapitaldecke bei fast 21 Prozent lag.
Bei der Unternehmensfinanzierung haben die öffentlichen Banken einen Marktanteil von 22 Prozent und sind mit 47 Prozent zugleich klarer Marktführer bei der Kommunalfinanzierung. Dunkel: „Auch diese Zahlen zeigen, dass öffentliche Banken heute mehr denn je ein wichtiger Finanzier und Partner der deutschen Wirtschaft sind.“ Bezüglich der immer wieder aufkommenden Debatte über mögliche Fusionen merkte Dunkel an, dass diese Frage letztlich nur von den Eigentümern beantwortet werden kann und Zusammenschlüsse auch kein reiner Selbstzweck sein dürfen, sondern nachprüfbare Mehrwerte für Kunden und Anteilseigner schaffen müssen.
Keine Vergemeinschaftung von Einlagensicherungssystemen
Klar lehnt der Spitzenverband der öffentlichen Banken die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung in der Euro-Zone ab. Hauptgeschäftsführerin Prof. Dr. Liane Buchholz: „Wir unterstützen die Bundesregierung in ihrer klaren Ablehnung. Für uns steht gleichzeitig fest: ‚First things first‘, also keine Vergemeinschaftung von Einlagensicherungssystemen, bevor nicht die bisher beschlossenen Maßnahmen der Bankenunion vollständig umgesetzt sind. Dies sind Voraussetzungen, die nicht parallel, sondern klar vor einer Europäischen Einlagensicherung erfüllt sein müssen. Dabei heißt Umsetzung nicht Abdruck in einem Amtsblatt, sondern tatsächliche Anwendung in der Praxis. Vorher ist jede Diskussion reine Zeitverschwendung!“
Der Bankenverband VÖB verweist darauf, dass bis heute 13 von 28 Mitgliedsstaaten die Einlagensicherungsrichtlinie und 9 von 28 Mitgliedsstaaten die Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD) noch nicht umgesetzt haben. Buchholz: „Die EU-Kommission sollte ihre Bemühungen auf die Umsetzung der verabschiedeten Regeln konzentrieren, anstatt verfrühte Debatten zu starten. Eine weitere Vergemeinschaftung ist und bleibt das falsche Signal an die Sparer.“