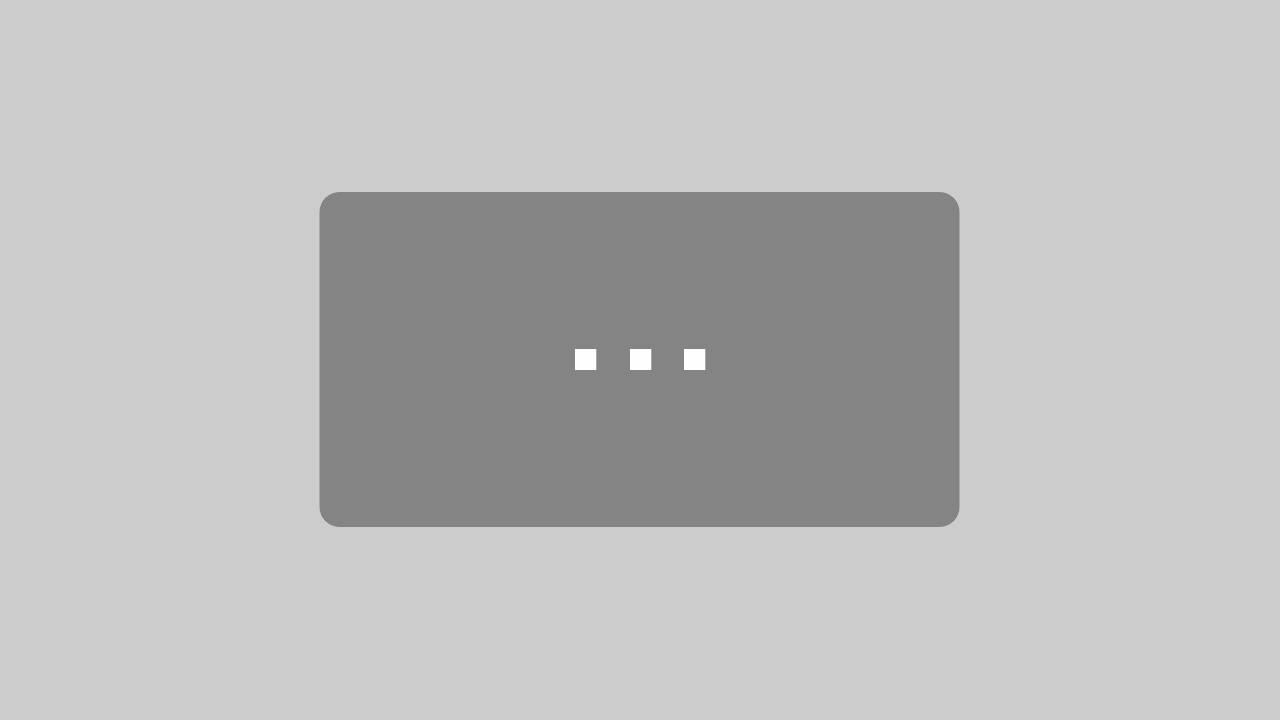Die Gründe für diese Entwicklung sind mannigfaltig. Sie liegen im Wesentlichen in dem Verkennen der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die europäischen Volkswirtschaften und deren Bankensysteme nach dem Fall der amerikanischen Investmentbank Lehman. Sowohl die Politiker in den einzelnen EU Ländern und in Brüssel als auch die Leitungen vor allem der deutschen Notenbank inklusive der EZB haben danach die Gefahrenlage für Europa vollkommen falsch eingestuft und dann in vielen Fällen falsche oder unwirksame Rettungsmaßnahmen ergriffen.
Obwohl allen politischen Entscheidungsträgern die Textbücher über die Depression der 30iger Jahre vorlagen, haben sie dennoch wieder Fehler begangen. Sie haben versucht, einen politischen Konsensus zur Lösung des Problems zu finden, der von Personen getragen wurde, die in der Mehrheit aufgrund ihrer Ausbildung keinen oder nur einen bedingten ökonomischen und finanzwirtschaftlichen Sachverstand hatten. Dann haben sie sich auf den Rat der Banker verlassen müssen, die das Chaos verursacht haben und sich heute zumeist im zwangsweisen Ruhestand befinden. In diesem Konflikt standen auch die Politbürokratie und ihre Notenbanker. Das galt insbesondere in Deutschland unter der damaligen konservativ-liberalen Regierung von Frau Merkel und gilt jetzt auch wieder unter der großen Koalition.
Die Haltung Deutschlands in dieser Frage war und ist deswegen so bedeutend, weil die deutsche Regierung und die Deutsche Bundesbank im Großen und Ganzen für die eingesetzten Maßnahmen verantwortlich zeichneten, während der Rest sie schweigend mitgetragen haben. Das war hauptsächlich die Implementierung der Spar- und Austeritätspolitik als Mittel zur Gesundung der Staatsfinanzen und die bis heute bestehende halbherzige Geldpolitik der EZB, die noch bis vor kurzem von den absurden Inflations- und Stabilitätsvorstellungen der Bundesbank gegängelt worden ist. Diese Maßnahmen haben einerseits vor zwei Jahren zu der Griechenland- und Euro-Krise geführt und können andererseits die EU erneut in eine Wirtschaftskrise stürzen, an deren Ende wieder die Diskussion um das Ende des Euro stehen wird. Deshalb sind die EU-Politik und die EZB jetzt gefordert, das Steuer um 180° herumzuwerfen und die dringenden Maßnahmen zu ergreifen, um die EU von dem Teufelskreis der Wachstumsanämie zu befreien, Arbeitsplätze zu schaffen und der schleichenden und sozial ungerechten realen Geldvermögensvernichtung breitester Volksschichten in Europa ein Ende zu setzen.
Die Zeit ist knapp geworden, weil sich nicht nur das heutige globale ökonomische Umfeld gegenüber 2009 zum Nachteil der europäischen Exportsituation als der bisherige Wachstumsmotor entwickelt hat. Es haben sich zudem in unserer unmittelbaren Nachbarschaft militärische Spannungsgebiete aufgetan, deren Ende und deren wirtschaftliche Auswirkungen bisher nicht zu quantifizieren sind. Das globale Wirtschaftswachstum hat sich im Verlauf der letzten Jahre von über 4% auf nunmehr weit unter 3% p.a. vermindert, und es ist nicht zu erkennen, dass sich in absehbarer Zeit eine Wachstumsumkehr anbahnen wird. Das hängt vor allem von der neuen politischen Führung Chinas ab, die gesellschaftliche und wirtschaftliche Exzesse der letzten Boom-Jahre mit Hilfe einer strikten Konsolidierungspolitik auszumerzen versucht. Das gilt aber auch für viele Länder der Peripherie in Asien und Süd-Amerika, in denen die Inflationsbekämpfung und die Geldwertstabilität jetzt in den Vordergrund der Politik gerückt worden sind. Dem gegenüber tut sich in Indien allerdings ein Hoffnungsschimmer nach den Wahlen im Frühjahr auf, das mit einer neuen Industrie- und Wirtschaftspolitik von Grund auf modernisiert werden soll. Allerdings wird es wohl Jahre dauern, bis Indien eine wichtigere Rolle als globaler Wirtschaftsfaktor einnehmen wird.
Das heißt für die EU Länder, dass sich dieser Wirtschaftsraum mit über 300 Millionen Menschen auf eigene Beine stellen muss, um langfristig überleben zu können. Das fängt zunächst mit der Zentralbankpolitik der EZB an. Die Liquiditätspolitik, die sich in der Entwicklung der Zentralbankbilanz manifestiert, ist in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. Das hat dem Bankensystem nicht geholfen, im Gegenteil, die meisten Banken hängen immer noch an den Zitzen der EZB und sind unfähig, aufgrund ihres unzureichenden Eigenkapitals und ihrer schlechten Ertragskraft ihre volkswirtschaftlichen Pflichten der privaten Kreditvergabe zu erfüllen. Der monetäre Transmissionsriemen funktioniert seit langem nicht mehr, und so schliddert die EU Schritt für Schritt in die Deflation. Auch das von der EZB initiierte System des LTRO, der gezielten langfristigen Refinanzierungsoperationen für die Banken war ein Schlag ins Wasser. Heute ist wohl klar, dass die EZB besser den Weg der Teilverstaatlichung wie seiner Zeit die amerikanische Notenbank eingeschlagen hätte und zunächst einmal nach der Lehmanpleite den gesamten privaten Bankenapparat unter ihre Fittiche genommen hätte, statt auf Selbstheilungskräfte der Banken zu hoffen.
Zudem hat es die bisherige EZB Politik auch nicht fertig gebracht, die seit November 2009 entstanden Zinsdifferenzen zwischen Deutschland und den Staaten der Peripherie wieder zu schließen. So muss Spanien für die Ausgabe von 10jährigen Anleihen gegenüber Deutschland fast 1.5% und Portugal 2.5% p.a. mehr aufwenden, ganz zu schweigen von Griechenland. Wenn diese Lücke nicht bald geschlossen wird, dann ist die nächste EURO-Krise bereits vorprogrammiert. Der EZB bleibt also nichts anderes übrig, als durch den massiven Ankauf von Staatsanleihen die Zinsen in der EU wieder anzupassen und zusätzlich strikte Maßnahmen zu ergreifen, die die Funktionsfähigkeit des europäischen Bankensystems wieder herstellen.
Diese Maßnahmen greifen langfristig nur dann, wenn darüber hinaus das Zusammenspiel mit den Länderregierungen und der EU-Administration in Brüssel gewährleistet ist. Das heißt im Klartext, dass die Fiktion der Gesundung der Staatsfinanzen über eine staatlich verordnete Sparpolitik über Bord geworfen werden muss. An deren Stelle muss ein EU-übergreifendes Infrastrukturprogramm in Verbindung mit fiskalischen Anreizen für die europäische mittelständische Industrie treten. In dieser Verantwortung stehen alle Staaten, auch wenn die Umsetzung solcher Maßnahmen in Italien und Frankeich wegen der bis heute ungelösten strukturellen politischen und wirtschaftlichen Verkrustungen ungleich schwerer fallen wird als vergleichsweise in Deutschland, Holland oder auch Polen. Es geht im Grunde um ein Nationen übergreifendes Erneuerungsprogramm in allen Bereichen der europäischen Infrastruktur, wie Verkehr, Telekommunikation, Gesundheitswesen oder alle öffentlichen Bereiche – ähnlich dem nach dem Krieg entwickelten Marschall Plan.
Die Modernisierung der europäischen Infrastruktur ist die Voraussetzung für die zukünftige volkswirtschaftliche Produktivität und Prosperität der EU. Sie ist jetzt notwendig, sie schafft Arbeitsplätze, Kaufkraft und am Ende wieder gesunde Staatsfinanzen. Bei der heutigen politischen Konstellation in Frankreich und Deutschland kommen allerdings Zweifel an der Machbarkeit eines solchen Mammutprogramms auf. Das deutsche Triumvirat Merkel, Schäuble und Gabriel scheinen mittlerweile soweit in ihrer Politwelt entrückt zu sein, dass sie den Ernst der Lage gar nicht mehr realistisch einschätzen können. Das gilt wahrscheinlich für Frankreich umso mehr. Dem Präsidenten Hollande scheinen die Zügel der Macht so sehr entglitten zu sein, dass er dem internen Parteien- und Gewerkschafts-Chaos heute ohnmächtig gegenüber steht. Man wird sehen, wann der öffentliche und wirtschaftliche Druck so groß wird, dass sich die Politiker der Europäischen Union endlich zu bewegen beginnen. Es gibt dann keinen Weg zurück. Sollte der Erfolg der europäischen Erneuerung irgendwann ausbleiben, dann wären die gesellschaftlichen und ökonomischen Konsequenzen eines Rückfalls in die Vor-Euro-Zeit eine für alle nicht auszumalende Katastrophe.
Frank Th. Zinnecker- HollyHedge Consult GmbH