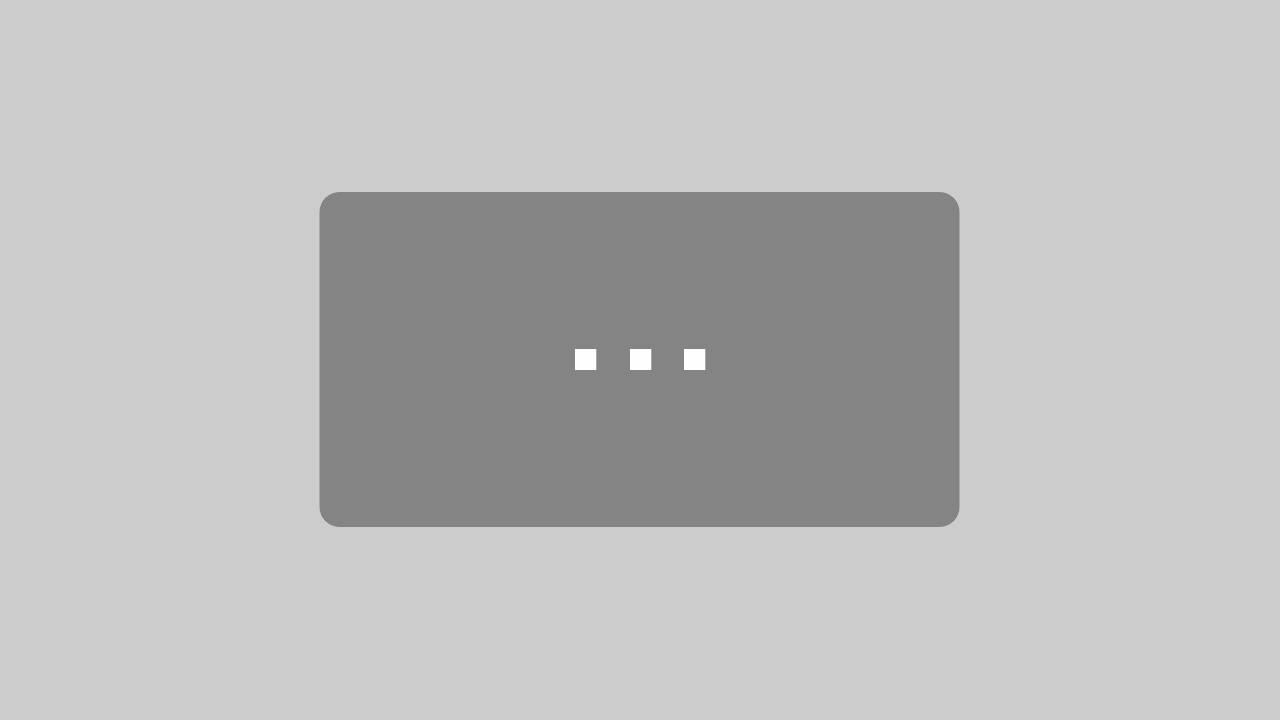Auf der anderen Seite ist Deutschland trotz der globalen Abschwächung wirtschaftlich weiterhin sehr gut aufgestellt und wird auch im nächsten Jahr der Wachstumsmotor für die EU bleiben. Die Arbeitslosigkeit ist trotz des Flüchtlingszustroms im Oktober auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gefallen. Zudem hat sich mit über 31 Mio. Sozialversicherten ein historischer Rekord eingestellt. Trotz dieser ermutigenden Zahlen haben die
wirtschaftlichen Risiken und die politischen Veränderungen der letzten Monate erheblich zur Verunsicherung an den Kapitalmärkten beigetragen. Deshalb hat EZB Chef Draghi bereits seinen Teil dazu beigetragen, indem er die Tür für eine weitere Lockerung der Geldpolitik nochmals weit aufgestoßen hat, was die Finanzmärkte nach den schwierigen Wochen mit einem unerwarteten Kursfeuerwerk begrüßt haben.
Ausblick
Damit ist die EZB allerdings mit ihrem Latein am Ende. Jetzt sind die Politiker in Berlin, Paris und Brüssel mit ihren Wirtschaftsverbänden gefordert, ihrerseits die seit Jahren schleppenden Investitionsentscheidungen in Gang zu setzten, um den Bürgern wieder eine sicherere Zukunft in Aussicht stellen zu können. Die Erneuerung und die Modernisierung alter Standorte die Planung und Entwicklung neuer Industrie-, Ausbildungs-, Gesundheits- und Sozialstandorte und kann nur durch ein EU-weites Konjunkturprogramm finanziert werden. Diese Aufgabe sollte in eine Agenda 2025 eingebettet sein, die aber auch eine Überarbeitung und Neuausrichtung der Fiskal- und Schuldenpolitik erfordert. Davon würden auch das EU Bankensystem und die Kapitalmärkte fundamental und nachhaltig profitieren.
Die übrigen Länder in der Welt bemühen sich, ihre Volkswirtschaften wieder auf Wachstum zu trimmen. China hat einmal mehr die Zinsen gesenkt, um die Konjunktur zu stimulieren. Außerdem hat die Regierung, zu diesem Zeitpunkt überraschend, die Ein-Kind-Politik aufgehoben, um der kommenden Überalterung der chinesischen Gesellschaft entgegen zu wirken. Die sozio-ökonomischen Konsequenzen werden beachtlich sein und sind noch gar
nicht zu quantifizieren. Mit anderen Mitteln versucht es Japan, das über den eingeschlagenen Weg der “Abenomics“ weiter an die Belebung der Konjunktur und der Inflation in 2016 glaubt.
In Europa erholen sich allmählich die übrigen Volkswirtschaften mit Hilfe des schwachen Euro und der niedrigen Ölpreise, wenn auch in unterschiedlicher Geschwindigkeit. In den USA ist die Situation anders. Trotz fast erreichter Vollbeschäftigung hat das flaue Lohnwachstum in Verbindung mit der schwachen Inflation den Fed bisher daran gehindert, die seit langem angekündigte und längst überfällige Zinserhöhung als ersten Schritt zur Normalisierung der Geldpolitik durchzuführen, was aber nach den letzten Daten wohl im Dezember nachgeholt werden wird.
Auf der andern Seite beginnen die Gewinne verschiedener US-Unternehmen zunehmend unter dem gestiegenen Dollar und den gestiegenen und nur teilweise überwälzbaren Lohnkosten zu leiden, weil die Unternehmen in der Vergangenheit nicht oder nur teilweise in die notwendige Verbesserung der Arbeitsproduktivität investiert haben.
Kapitalmarktaussichten
Die Furcht vor einer durch China ausgelösten globalen Rezession, die die Kapitalmärkte in den letzten Monaten in Atem gehalten haben, ist wohl vom Tisch. Nachdem die Konsolidierung der westlichen Aktienmärkte ihr Ende gefunden hat, sollten diese ihre Aufwärtsbewegung in Richtung 2016 wieder aufnehmen. Diese Bewegung wird allerdings aus zwei Gründen wesentlich differenzierter als in der Vergangenheit verlaufen. Der seit 2009 bestehende
Finanzzyklus ist nach sechs Jahre in seine Spätphase eingetreten. Auf der anderen Seite ist die ökonomische Ausgangssituation fundamental von Land zu Land und Sektor zu Sektor verschieden und zugleich im Ablauf teilweise zeitverschoben.
Das gilt für die Renten- und Aktienmärkte wie für die Währungen gleichermaßen. So werden sich die Rentenmärkte in der EU auf Grund des von der EZB bereits gesteckten Liquiditäts- und Zinsrahmens anders entwickeln als die der USA, die am Ende ihrer Niedrigzinspolitik angekommen sind. Bei den Aktienbörsen sollte das Bild noch differenzierter ausfallen. Viele Sektoren und Unternehmen werden in der Spätphase der schwächer werdenden Zyklen mit zyklisch aber auch strukturell veränderten Geschäfts- und Absatzbedingungen, sinkenden oder steigenden Cashflows und Unternehmensgewinnen konfrontiert sein. Diese Entwicklung wird die zukünftigen Aktienstrategien und Portfoliozusammensetzungen verändern. Nicht die Märkte, sondern vielmehr einzelne Sektoren und Aktien werden die Performancetreiber sein.
Dieser Trend hat sich bereits in der laufenden Korrektur und der sich jetzt anschließenden Bodenbildung abgezeichnet. So befinden sich heute bereits einzelne Sektoren und Aktien sowohl in Bären- als auch in Bullenmärkten. Zum Beispiel sind Einzelhandelsunternehmen, viele zyklische Industrien wie Rohstoffe, Gold, Energie und Investitionsgüter seit Monaten in Abwärtstrends, während Konsumgüterunternehmen des täglichen Gebrauchs, Internet- und Software-Services, Gesundheits- und Bio-Tech-Unternehmen mit weiter steigenden Cashflows und Gewinnen neue Höchstkurse verzeichnen. Historisch sind spätzyklische Börsen Momentum getrieben, und das sollte sich grundsätzlich in Zukunft auch nicht ändern.
Von Frank Th. Zinnecker, Geschäftsführer, HollyHedge Consult GmbH