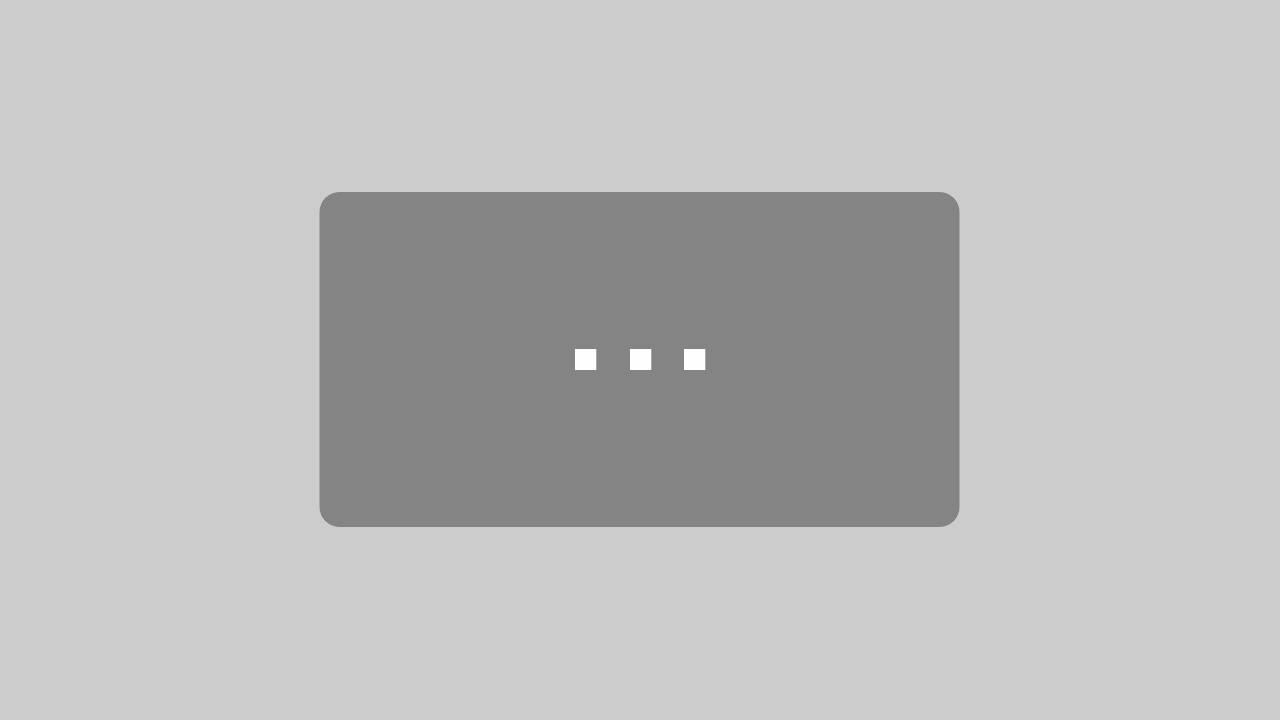Ein Paradebeispiel dafür ist die Intervention der Regierung, die auf die anfängliche Korrektur am A-Aktien-Markt im Juli dieses Jahres folgte. Diese wurde außerhalb Chinas weitgehend als panikartige Reaktion interpretiert. Doch Chinas Aktienmarkt wird größtenteils von Privatanlegern bestimmt und die Aufrechterhaltung einer sozialen Harmonie besitzt für den Einparteienstaat eine überragende Bedeutung zum Erhalt der inneren Stabilität.
Aber wie kann die Abwertung der Landeswährung interpretiert werden, die China nur wenige Wochen vor dem anstehenden ersten offiziellen Besuch von Präsident Xi in den USA vollzogen hat? Dieser Schritt wurde weithin als ein Versuch Pekings aufgefasst, seine ins Stocken geratene Exportwirtschaft wiederzubeleben. Und das Timing für diese Maßnahme erscheint – zumindest politisch – ungeschickt. Denn US-Politiker beschuldigten China jahrelang, den Renminbi künstlich hoch zu halten, und der bilaterale Handel wird beim Zusammentreffen von Präsident Xi mit Präsident Obama ein wichtiges Gesprächsthema sein.
Die Mär der kompetitiven Abwertung
Wir teilen diese allgemeine Auffassung jedoch nicht. Aus unserer Sicht ist die Währungsanpassung viel eher ein weiteres Beispiel dafür, wie einfach es ist, Chinas politisches Handeln falsch zu interpretieren.
Bewertet man die Maßnahme als eine kompetitive Abwertung, wird eine Reihe von Fakten ignoriert. Dazu zählt etwa, dass sich Chinas Exporte trotz Schwierigkeiten sehr viel besser entwickelten, als die regionaler Wettbewerber. Allein aus diesem Grund ist kaum nachzuvollziehen, warum eine kompetitive Abwertung notwendig gewesen wäre. Außerdem ist Chinas Handelsbilanz positiv – die Importe sinken schneller als die Exporte – und das Land hat einen erheblichen Handelsbilanzüberschuss. Eine Abwertung würde diese Probleme folglich noch verschlimmern, und das genau zum politisch falschen Zeitpunkt.
Weit plausibler ist nach unserer Auffassung daher die Erklärung der chinesischen Zentralbank „People’s Bank of China“, dass mit der Abwertung der Landeswährung eine ungewöhnlich große Lücke zwischen dem Fix- und dem Kassakurs der Währung geschlossen werden sollte. Die Zentralbank senkte den Fixkurs nur um 1,9% und intervenierte am Markt, um so die unter Druck geratene Währung nach Publikation der Abwertung zu stützen. Sinnvoll war die Anpassung auch als Ausdruck der Regierungspolitik. Denn mit dem Einsatz nationalen und internationalen Privatkapitals zielt die Maßnahme auf die Modernisierung und Diversifizierung der Wirtschaft ab. Um dies zu erreichen, benötigt China eine stärker am Markt orientierte Währung.
Die Kaufkraft chinesischer Konsumenten wächst
Unsere Recherchen deuten darauf hin, dass China weniger auf seine Währung fokussiert ist, sondern vielmehr auf das Lenken notwendiger Liquidität in die richtigen Teile der Binnenwirtschaft. Neben den traditionellen Triebkräften des Export- und Investmentsektors kann so der Konsum zu einem stärkeren Wachstumsmotor Chinas werden.
Präsident Xi kann seinem Amtskollegen Obama in dieser Hinsicht gute Nachrichten überbringen: Die jüngsten Daten zeigen eine Annäherung der Trends bei den Investitionen in Anlagegüter und den Einzelhandelsumsätzen, wobei erstere zurückgehen und letztere stabil bleiben (siehe nachfolgende Abbildung). Obwohl die Zahlen allein nicht besonders spektakulär anmuten, deuten sie dennoch auf Chinas Rückkehr zu einem wirtschaftlichen Gleichgewicht hin. Für den Welthandel sind dies positive Anzeichen: Sie belegen die wachsende Kaufkraft chinesischer Verbraucher, die bereits im internationalen Tourismus sowie beim Erwerb ausländischer Luxusgüter kräftig mitmischen.
Von Hayden Briscoe, Director Asia-Pacific Fixed Income bei AB mit Sitz in Hongkong