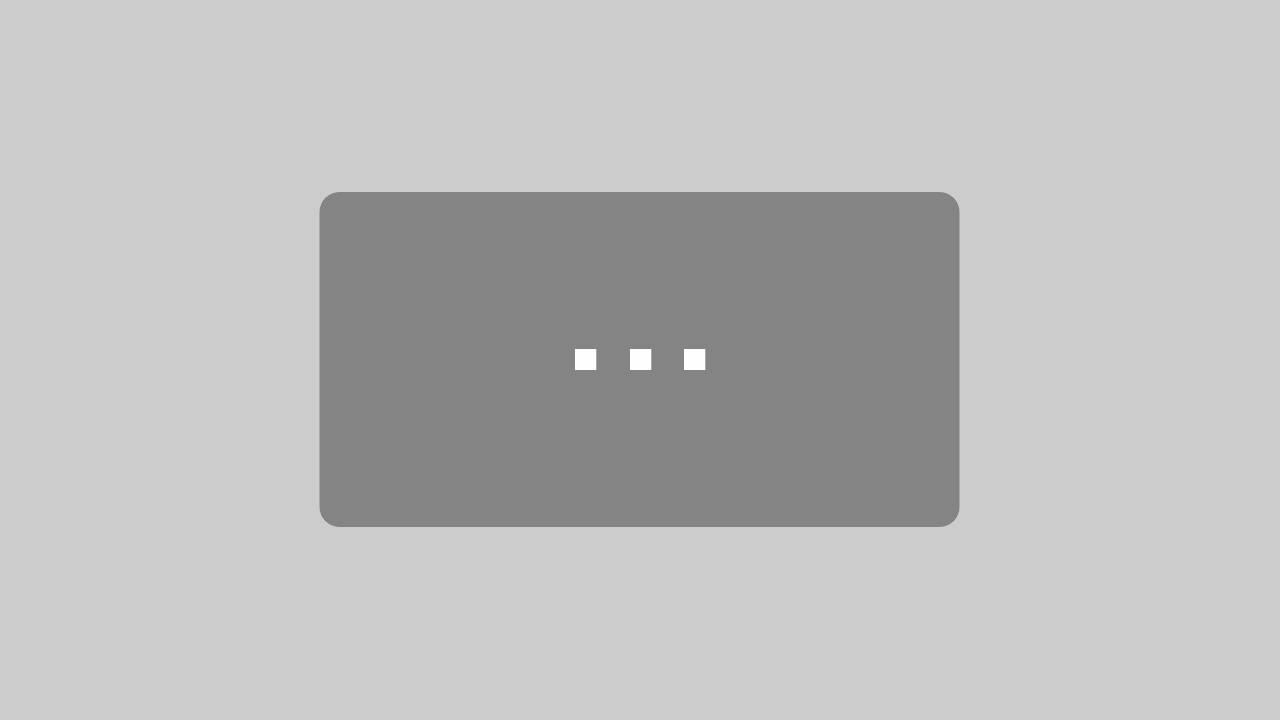Die Anbindung des Yuan an den US-Dollar ist fundamental nicht länger gerechtfertigt
China muss seine Geldpolitik stärker lockern, wenn die Behörden die Kapitalabflüsse stoppen wollen. Diese wirken ungewollt restriktiv, weil sie die Liquidität im Inland senken. Der Wechselkurs muss als weiteres geldpolitisches
Instrument angesehen werden, vor allem vor dem Hintergrund der Konjunkturabkühlung und des schwächeren Exportwachstums. Dies gilt umso mehr, als der Yuan seit Anfang 2014 relativ stabil zum US-Dollar notierte. Davor wertete die chinesische Währung sogar auf und folgte dem aufwärts tendierenden US-Dollar seit dem Sommer 2014 – trotz sehr unterschiedlichen Wachstumsmustern in beiden Volkswirtschaften. Seit dem Sommer 2011 hat der Yuan handelsgewichtet um rund 30 Prozent zum US-Dollar zugelegt. Unterdessen scheint es, als ob der US-Dollar weiter an Wert gewinnen wird, weil die US- Notenbank Fed voraussichtlich noch im laufenden Jahr einen Zinserhöhungszyklus beginnen dürfte. Den Yuan zum US-Dollar in einem solchen Umfeld stabil zu halten, hätte zur Folge, dass China die restriktive Geldpolitik der USA «importieren» würde – ein Szenario, das die chinesische Wirtschaft noch stärker belasten würde. Aus diesem Grund erscheint die Anbindung des Yuan an den US-Dollar nicht gerechtfertigt.
Wie weit könnte der Yuan sinken?
Obwohl China eine stärkere Flexibilisierung des Yuan zulässt, ist nicht davon auszugehen, dass die PBOC eine extreme Währungsfluktuation tolerieren wird. Eine massive Abwertung würde diversen Wirtschaftszweigen Schaden zufügen. Die Anlegerstimmung könnte in Pessimismus umschlagen, was an den Aktienmärkten zu weiteren Kursverlusten führen und den Kapitalabfluss beschleunigen könnte. Ausserdem würden chinesische Institutionen, die ihre Positionen in Dollar-Schuldpapieren mit Krediten finanziert haben, in Schwierigkeiten geraten, falls der Yuan massiv abwertet. Es ist daher zu bezweifeln, dass ein solches Szenario im Interesse der chinesischen Behörden ist. China hat nach wie vor genügend Möglichkeiten, die Währung zu kontrollieren – die Devisenreserven belaufen sich auf 3600 Milliarden US-Dollar.
Diese Zahl ist trotz der Tatsache, dass Kapitalflucht und PBOC-Interventionen den Bestand um 300 Milliarden US-Dollar geschmälert haben, äusserst eindrücklich.
Aus fundamentaler Sicht ist eine weitere moderate Abwertung des Yuan durchaus sinnvoll, sofern sich die globalen und inländischen chinesischen Wachstumsfaktoren nicht zugunsten von China verschieben, wofür bislang keine Anzeichen zu erkennen sind. Man könnte von einer sukzessiven Konjunkturabkühlung in China auf 6.9 Prozent in diesem Jahr und auf 6.6 Prozent im Jahr 2016 ausgehen. Mit anderen Worten müsste das offizielle Wachstumsziel Chinas von 7 Prozent in den kommenden Quartalen gesenkt werden.
Auswirkungen auf die Schwellenländer
Als Reaktion auf die Ankündigung der chinesischen Zentralbank gaben «Emerging Markets»-Währungen (EM) anfänglich nach, insbesondere diejenigen von asiatischen Volkswirtschaften. Diese sind schliesslich wirtschaftlich eng mit China verflochten. Ein schwächerer Yuan schmälert – bei sonst gleichen Bedingungen – die Wettbewerbsfähigkeit dieser Währungen.
Auswirkung auf die Finanzmärkte
Eine Abwertung des Yuan zum US-Dollar von 3 Prozent in den vergangenen beiden Tagen ist per se nicht erheblich, insbesondere nach einer längeren Aufwertungsphase. Die Auswirkungen auf die Märkte sind jedoch ziemlich relevant. Die Abwertung bestätigt, dass die chinesische Wirtschaft unter enormem Druck steht, so dass die Entscheidungsträger gezwungen sind, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um das Wachstum zu stabilisieren –
auch über die Exporte.