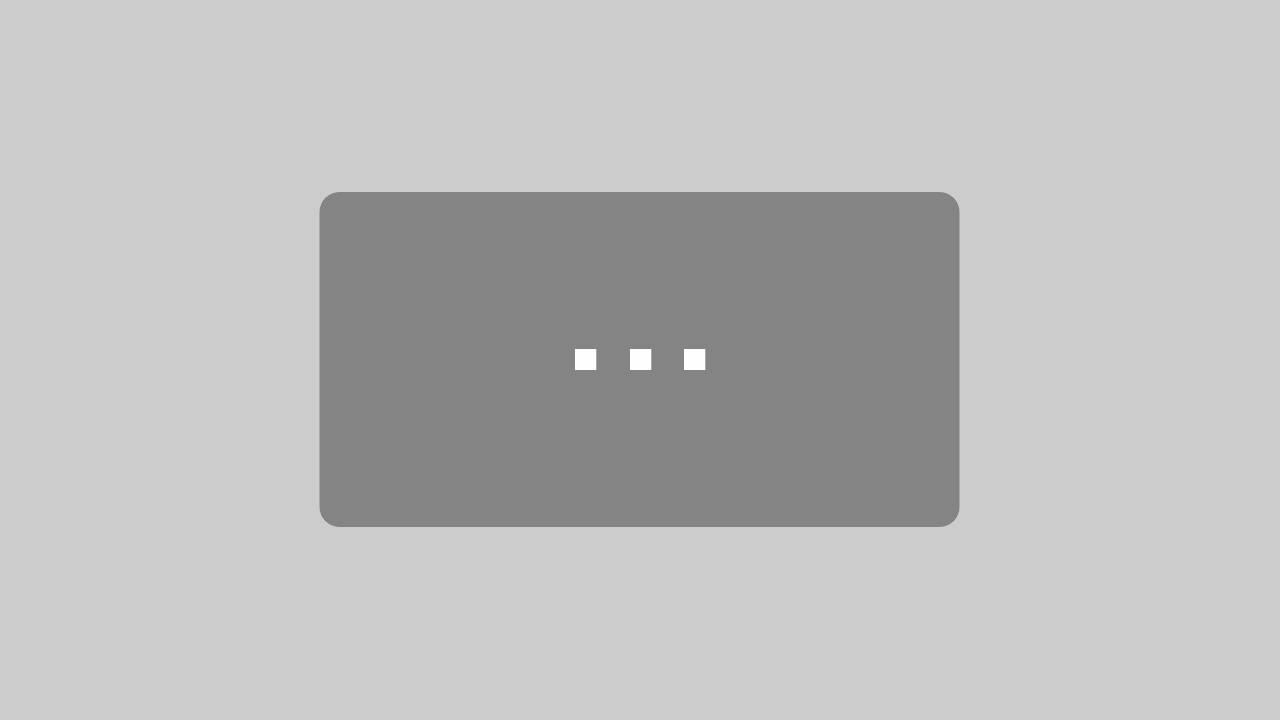In der Stichprobe, die das Gesamtportfolio abgeschlossener Vorhaben repräsentiert, wurden rund 82 % der Projekte und 84 % des Mittelvolumens als erfolgreich klassifiziert.
„Trotz des in vielen Partnerländern zunehmend schwierigen Umfelds bestätigt unsere Evaluierung: Die große Mehrheit der Projekte trägt nachhaltig zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen bei. Eine gute Nachricht angesichts der hohen Erwartungen, die auch wir selbst an unsere Arbeit stellen,“ sagt Dr. Norbert Kloppenburg, Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe. „Da die Anforderungen aktuell eher noch steigen – zu den Prioritäten von Armutsbekämpfung und Umwelt- und Klimaschutz kommt die Bekämpfung von Fluchtursachen hinzu -, sollten wir aber auch die andere zentrale Botschaft des Berichts sehr ernst nehmen. Verschiedene Ziele lassen sich trotz gleichermaßen hoher Priorität selten innerhalb eines Ansatzes realisieren. Gezielte Unterstützung verspricht effektivere Resultate, auch wenn dies im Einzelfall schwierige Entscheidungen fordert.“
FZ-Projekte im ländlichen Raum zeigen das Ausmaß von Spannungsfeldern. Maßnahmen zur Minderung der Armut von Kleinbauern sind nicht gleichzusetzen mit Projekten zugunsten einer modernen, produktionsintensiven Agrarwirtschaft. Projekte zum globalen Schutz von Natur und Klima liegen nicht immer auch im Interesse der armen lokalen Bevölkerung. Selbst Armutsbekämpfung durch ländliche Infrastruktur ist nicht frei von Spannungsfeldern. Diese Maßnahmen kommen zwar vor allem der armen Bevölkerung zugute, die weltweit zu 80 % auf dem Land lebt; sie sind jedoch im Vergleich zu städtischer Infrastruktur pro Einwohner sehr teuer. Innovative und mobile Lösungen – wie z.B. Wanderschulen in Mali – bringen Abhilfe, bedeuten aber dennoch Abstriche im Vergleich zur flächendeckenden Versorgung in der Stadt. „Von einem einzelnen Projekt wird häufig zu viel verlangt; es wird mit Zielen überfrachtet. Nicht das einzelne Projekt, sondern die Gesamtheit aller Maßnahmen, einschließlich der nationalen Politik, muss den Herausforderungen gerecht werden – mit tragfähigen Ansätzen für Mensch und Natur“, sagt Prof. Dr. Eva Terberger, Leiterin der Evaluierungsabteilung, die den Bericht vorstellte.
„Unsere Evaluierung soll nicht nur die Öffentlichkeit über den Erfolg unserer Arbeit transparent informieren, sie hilft uns auch, aus Erfahrungen zu lernen und noch besser zu werden“, ergänzt Dr. Kloppenburg. Dieses Anliegen spiegelt sich in der Auswahl der Evaluierungsbeispiele im Bericht. Nicht nur die als besonders erfolgreich eingestufte Einrichtung von Wildkorridoren im armen Nordosten Namibias wird vorgestellt, sondern auch die weitgehend fehlgeschlagene Unterstützung für die Wettbewerbsfähigkeit der vietnamesischen Eisenbahn.