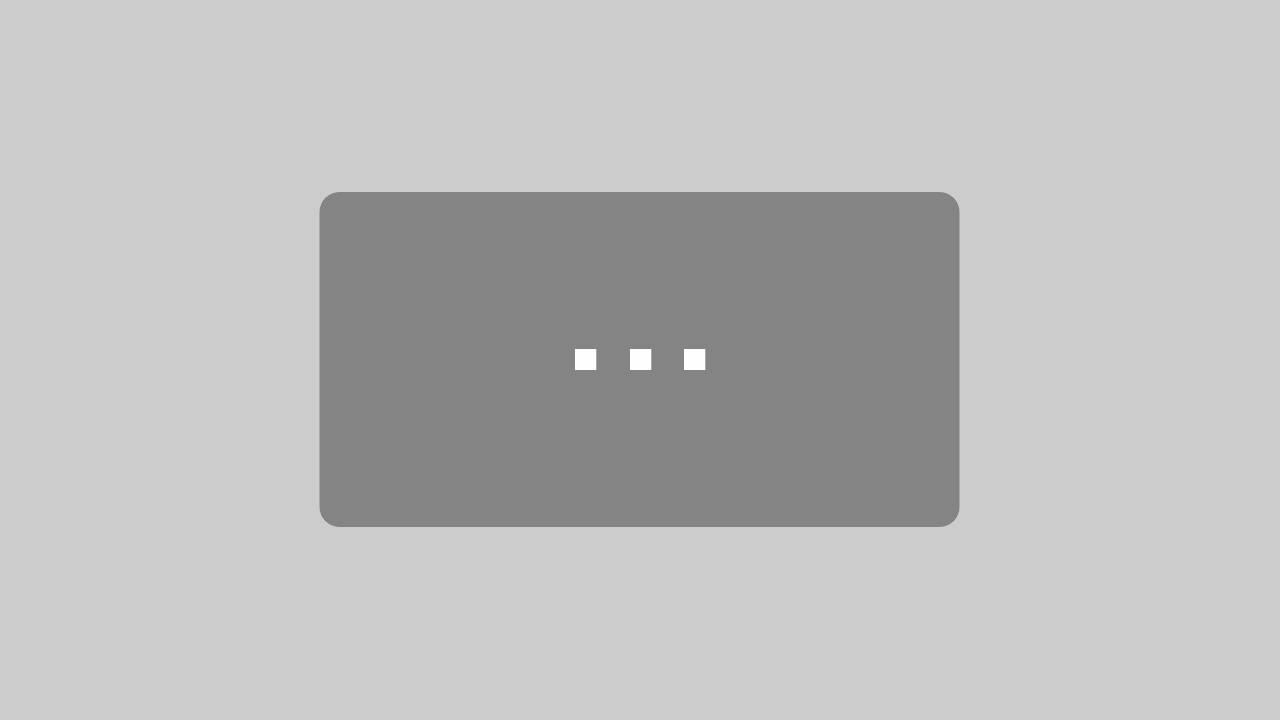Wir erinnern uns: Der Streit zwischen der italienischen Regierung und der EU-Kommission im Herbst 2018 entzündete sich daran, dass erstere für 2019 mit einem Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung planen wollte, letztere aber auf Zusagen der Vorgängerregierung pochte, nach denen das Defizit höchstens 0,8 Prozent des BIP betragen sollte. Nach langem Hin und Her wurde schließlich ein „Kompromiss“ gefunden, wie er für den Umgang Brüssels mit großen EU-Mitgliedsländern typisch ist: Der italienischen Regierung wurde für das Jahr 2019 ein Defizit von 2,05 Prozent des BIP zugestanden, garniert mit vagen Absichtserklärungen, in den kommenden Jahren das Defizit abzubauen.
Defizitziele werden nicht eingehalten
Nur wenige Monate später zeichnet sich bereits ab, dass das Defizit bei unverändertem Haushalt am Jahresende mindestens 2,6 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen wird, also höher ausfällt als im ursprünglichen Haushaltsplan der Regierung. Jetzt zeigt sich, dass die Wachstumserwartungen der italienischen Regierung für das Jahr 2019 viel zu optimistisch waren. Man kalkulierte damals mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum von 1,5 Prozent. Tatsächlich wird die italienische Wirtschaft im laufenden Jahr höchstens graduell wachsen – der Konsenswert liegt derzeit bei 0,3 Prozent. Dass es wesentlich mehr sein könnte, glaubt außer den italienischen Arbeitgebern (0,9 Prozent) eigentlich niemand. Und es könnte sogar noch schlimmer kommen: Inzwischen liegen die Einkaufsmanagerindizes nicht nur in der Industrie, sondern auch im Dienstleistungssektor unterhalb von 50 Punkten und signalisieren damit ein andauerndes Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Die Industrieproduktion liegt 2 Prozent unter dem Vorjahreswert, die Auftragseingänge sogar 4 Prozent, die Autoverkäufe knapp 5 Prozent. Der Umsatz mit Dienstleistungen lag schon im Herbst nur noch knapp über dem Vorjahreswert und dürfte seitdem nicht besser geworden sein. Die Arbeitslosenquote sinkt zwar in der Tendenz, ist aber mit mehr als 10 Prozent nach wie vor viel zu hoch, als dass sich daraus positive Impulse für den Konsum ableiten ließen. Und tatsächlich hat sich denn auch das Konsumentenvertrauen seit etwa einem Jahr spürbar eingetrübt.
Es fehlt nach wie vor an durchgreifenden Reformen
Das Kernproblem der italienischen Wirtschaft bleibt die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Die Produktivität pro Arbeitnehmer liegt erschütternde 3,5 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2000, und keine Regierung seitdem hat es vermocht, mittels Bürokratieabbau, Deregulierung und anderer Reformen zur Verbesserung der Angebotsbedingungen eine Trendwende herbeizuführen. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass es der Regierungskoalition um die Herren Salvini und Di Maio ebenfalls nicht gelingen wird. Die Einführung eines Bürgergelds mag zwar den privaten Konsum stützen, für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ist damit jedoch nichts gewonnen.
Die Kreditwürdigkeit Italiens steht auf dem Spiel
Angesichts der anhaltend schlechten Perspektiven für Italiens Wirtschaft stellt sich seit einiger Zeit die Frage nach der Kreditwürdigkeit des Landes. Die Ratingagentur Moody’s bewertet Italien schon seit längerem gerade noch so mit dem Prädikat „Investment Grade“. Sowohl S&P als auch Fitch liegen in ihren Einschätzungen jeweils eine Stufe darüber. Fitch hatte zuletzt wissen lassen, an dieser Einschätzung samt negativem Ausblick festzuhalten, muss sich aber fragen lassen, wie viel Negatives eigentlich noch geschehen müsste, bis aus dem Ausblick eine Herabstufung des Ratings wird. Geschieht nicht bald ein Wunder, wird wenigstens eine der beiden Agenturen den Mut finden müssen, die Kreditwürdigkeit Italiens herabzustufen. Mit der Ruhe an den Kapitalmärkten – zuletzt hatte sich der Renditeabstand zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen auf etwa 250 Basispunkte eingependelt – dürfte es spätestens dann vorbei sein. Der Streit um die Tragfähigkeit der italienischen Staatsfinanzen ist also vorerst aufgeschoben, ganz sicher aber nicht ausgestanden.
(FERI Gruppe)