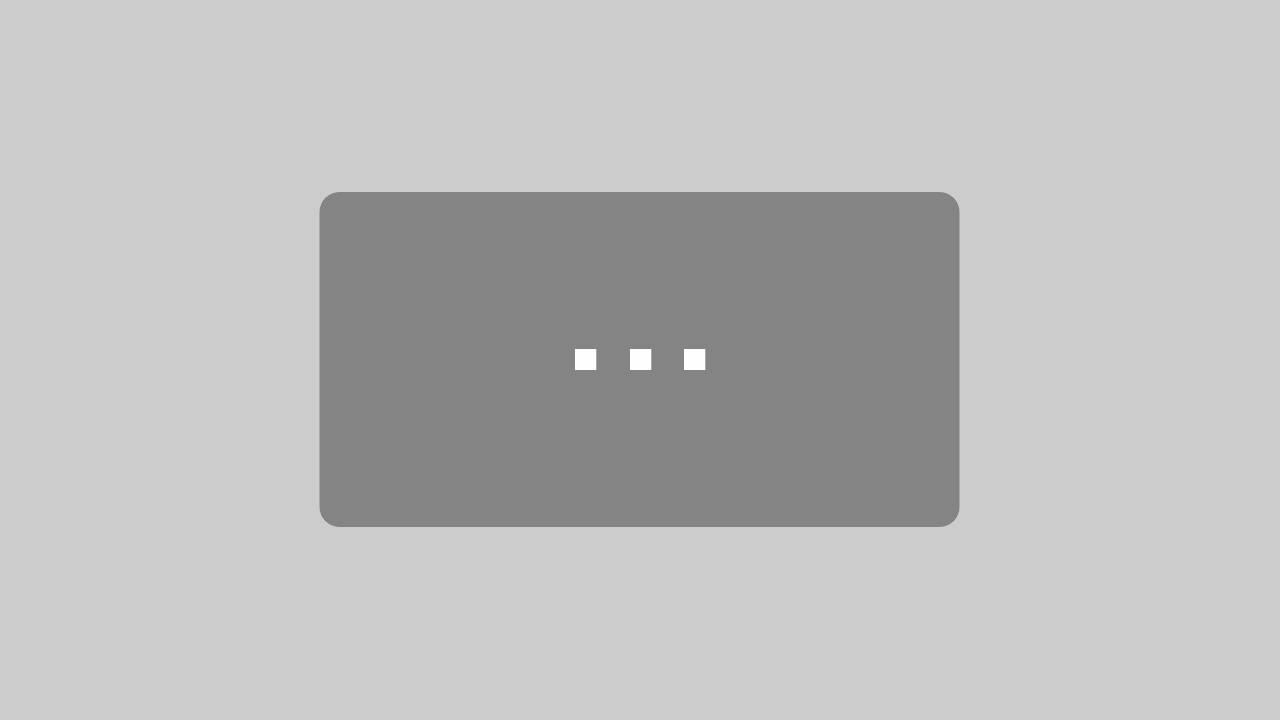Grund für diese ernüchternde Erkenntnis sind vor allem die aktuell hohen Schuldenquoten im Verein mit den niedrig anzusetzenden Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im Euroraum. „Solange die Inflationsrate unter oder auf dem von der EZB angestrebten Zielwert von zwei Prozent bleibt, verzinsen sich die Staatsschulden trotz niedriger Zinsen schneller als die Wirtschaft wächst. Der gewünschte Effekt eines ‚Aus-den-Schulden-Herauswachsens‘ kommt somit nicht zustande“, so Hans-Jörg Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei AllianzGI und Autor der Studie.
Höhere Inflation nur scheinbare Lösung
Welche anderen Stellschrauben gibt es zur Verringerung der öffentlichen Schuldenquoten? Auf den ersten Blick könnten höhere Teuerungsraten in der Eurozone helfen. Die Simulation von AllianzGI zeigt, dass unter ansonsten unveränderten Annahmen die EWU-Staatschuldenquote bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von vier Prozent etwa im Jahr 2032 wieder Maastricht-konforme 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen könnte. Bei einer Teuerungsrate von sechs Prozent wäre dieser Schwellenwert sogar schon etwa 2024 realisierbar. Aber: Derart hohe Inflationsraten wären ein klarer Verstoß gegen das Stabilitätsmandat der EZB. Sie sind daher längerfristig schwer vorstellbar. Darüber hinaus wäre zu erwarten, dass in einem derartigen Fall alle anderen Größen eben nicht unverändert blieben: So dürften hartnäckig höhere Teuerungsraten auch höhere Zinsen und damit höhere Finanzierungskosten für die Finanzminister nach sich ziehen. Es erscheint somit zweifelhaft, dass eine erhöhte Inflation dauerhaft zu einer Situation führen kann, in der das nominale Wirtschaftswachstum über dem nominalen Zinsniveau liegt.
Haushaltsdisziplin als einziger Ausweg
Sofern es keinen unerwarteten Wachstumsboom gibt, liegt die eigentliche Lösung zum Schuldenabbau damit bei den Primärhaushalten: Nur wenn die Staaten öffentliche Budgetüberschüsse erwirtschaften, können die Staatsschuldenquoten auch bei einer zielkonformen Inflationsrate innerhalb überschaubarer Zeiträume zurückgeführt werden. Wie hoch die Primärüberschüsse ausfallen müssen, ist dabei vom Ausgangsniveau der Staatsverschuldung abhängig und somit von Land zu Land verschieden. In Deutschland würde im Vergleich zum Basisszenario, das lediglich von einem ausgeglichenen Primärsaldo[1] ausgeht, ein Primärüberschuss von einem Prozentpunkt ausreichen, um die Staatsschuldenquote bis etwa 2022 wieder auf 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zurückzuführen. Ausgehend von der durchschnittlichen Schuldenquote in der Eurozone würde es der Simulation zufolge bis etwa 2041 dauern. In Spanien und vor allem Italien wären dagegen höhere Primärüberschüsse notwendig. Fazit Naumer: „Es zeigt sich sehr deutlich: Was für private Häuslebauer gilt, gilt auch für Staaten – ein Abstieg vom Schuldengipfel gelingt nur über Sparsamkeit. Dabei reicht es nicht, die öffentlichen Primärhaushalte lediglich auszugleichen. Vielmehr müssen Überschüsse erzielt werden. Darüber hinaus gehört auf die politische Agenda eines jeden Landes, Wachstumsbremsen zu lockern. Dies würde ein Herauswachsen aus den Schulden und damit einen Schuldenabbau unterstützen.“