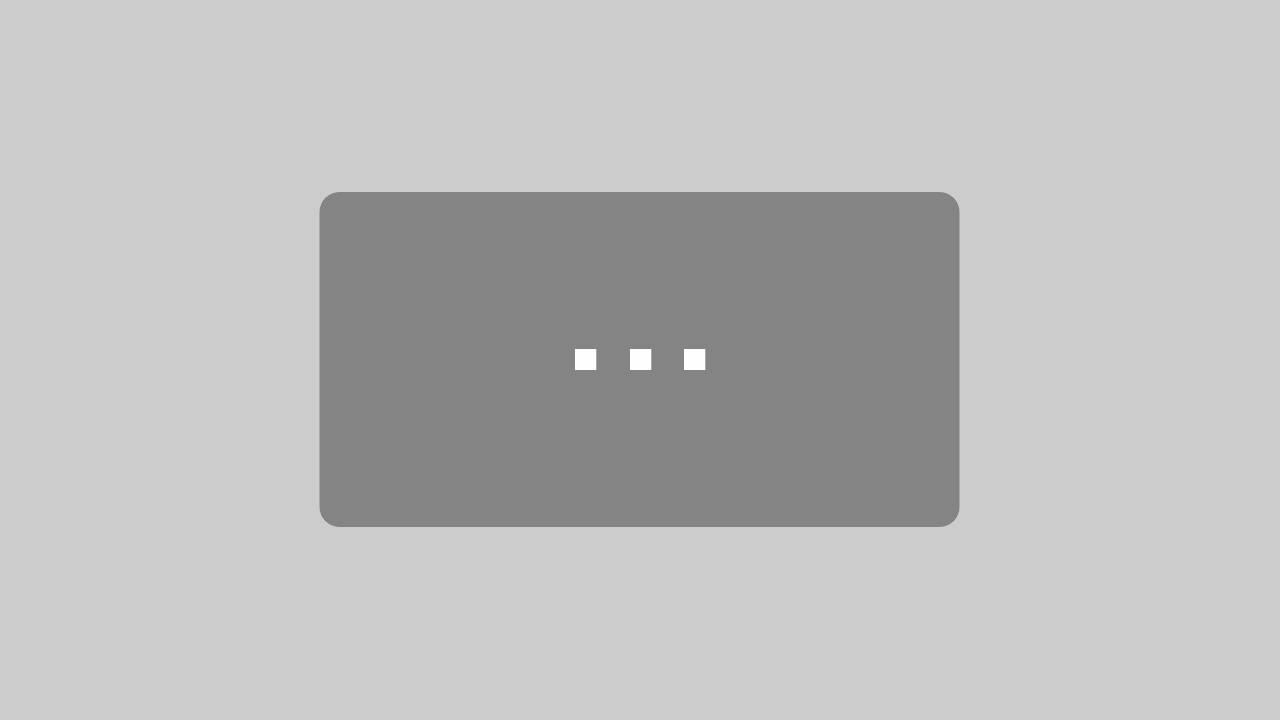3. Realwirtschaftliche Integration
Europa muss seine volkswirtschaftlichen Ungleichgewichte korrigieren, die andernfalls weiterhin für Instabilität sorgen. Wir haben bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass dies in einem Rahmen stattfinden sollte, der innereuropäische Leistungsbilanzdefizite und ihre Ursachen systematisch überwacht und korrigiert. Die Korrekturmechanismen müssen dabei dergestalt sein, dass Symmetrie zwischen Überschuss- und Defizitländern hergestellt wird. Das ist (in gewissem Umfang) durch überzeugende Strukturreformpläne zu erreichen. Und tatsächlich scheint dieser Ansatz bereits Formen anzunehmen. In jedem Fall werden positive Effekte sich erst langfristig bemerkbar machen.
4. Flexiblere EZB-Politik
Die Einführung von Eurobonds wäre auch insofern positiv, als dass es der EZB die Übernahme der Funktion eines LOLR erleichtern würde. Dazu sind Eurobonds zwar keine notwendige Voraussetzung, aber die EZB hat bislang gezögert, in der gegenwärtigen Situation in diese Rolle zu schlüpfen, um Moral-Hazard-Effekte aufseiten von Staatsschuldnern zu vermeiden. Die Funktion als echter LOLR könnte auch Folge einer Neuausrichtung des EZB-Mandats sein, weg vom engen Fokus auf Preisstabilität hin zu einer stärkeren Orientierung an finanzieller Stabilität. Daneben könnte die EZB auch ihr Inflationsziel anheben, um Anpassungen bei den relativen Teuerungsraten der einzelnen Länder zu erleichtern. Ferner muss auch die makroprudenzielle Überwachung des Finanzsektors gestärkt werden. Auch diese Rolle könnte die EZB übernehmen; ebenso gut könnte sie aber auch der bereits unter Ziffer 2 skizzierten paneuropäischen Bankenaufsicht zufallen.
5. Europaweiter Investitions- bzw. Wachstumspakt
Die Kriterien 1 bis 4 sind für ein stabiles Krisenfinale unerlässlich. Ein europaweiter Investitions- bzw. Wachstumspakt wäre dagegen eine optionale flankierende Maßnahme, um dieses Ziel zügiger und reibungsloser umzusetzen. Davon würden nicht nur alle Länder gleichermaßen profitieren, es würde auch der Negativspirale aus angeschlagenem finanziellem Vertrauen und tatsächlicher realwirtschaftlicher Leistung ein Ende setzen. Angesichts der zunehmenden politischen Polarisierung in vielen Euro-Ländern könnte die Wachstumsförderung durchaus eine weitaus wichtigere Maßnahme sein, um sich der öffentlichen Unterstützung zu versichern, als manche Experten meinen.